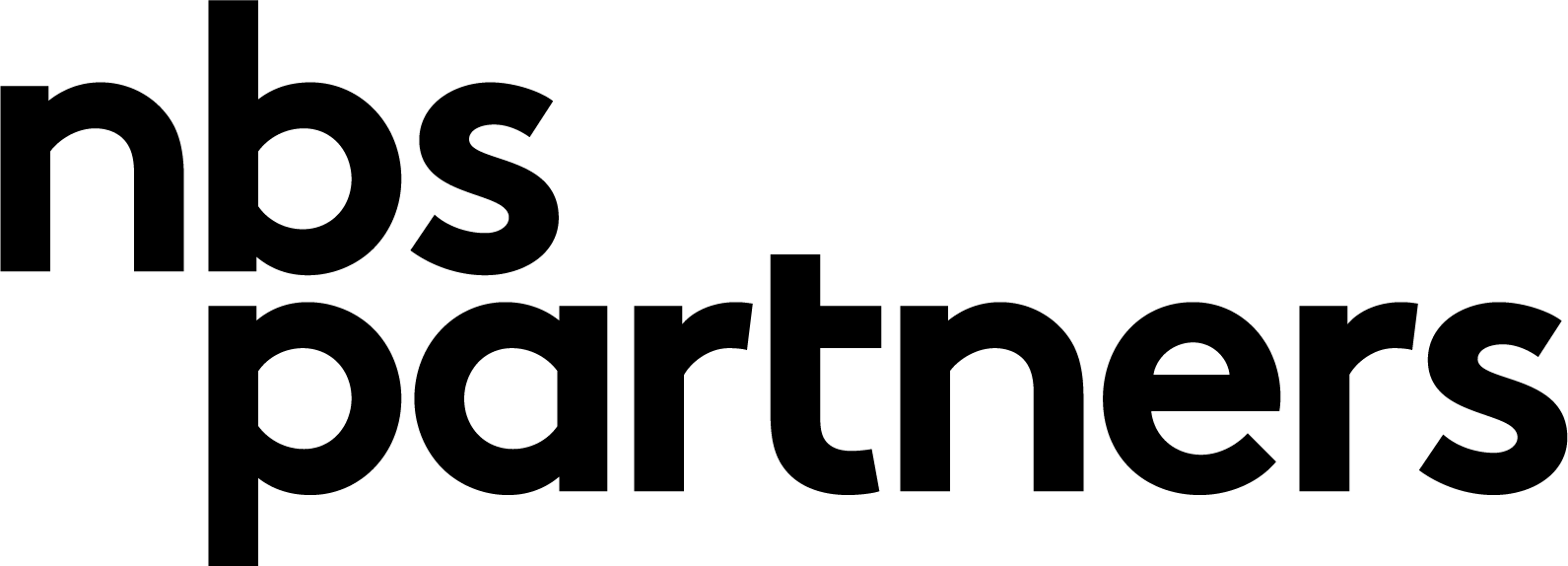Die Befristung von Arbeitsverhältnissen spielt in der Praxis eine erhebliche Rolle. Für den Arbeitgeber bedeuten befristete Arbeitsverhältnisse vor allem Flexibilität und die Vermeidung von aufwendigen und kostenintensiven (betriebsbedingten) Kündigungen, denn das Arbeitsverhältnis endet automatisch mit dem Ablauf der Befristung (§ 15 Abs. 1 TzBfG). Gleichzeitig ist aber auch zu beachten, dass bei Vereinbarung einer Befristung der Ausspruch einer ordentlichen Kündigung ausgeschlossen ist, sofern das Recht zur ordentlichen Kündigung nicht einzelvertraglich oder tarifvertraglich vereinbart worden ist (§ 15 Abs. 4 TzBfG).
Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Der Privatautonomie wurde vom Gesetzgeber aus sozialstaatlichen Gründen eine Grenze gesetzt. Die Vereinbarung von befristeten Arbeitsverhältnissen ist daher an das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen geknüpft. Zu unterscheiden ist hierbei insbesondere zwischen der Sachbefristung und der sachgrundlosen Befristung.
I. Sachgrundbefristung
Die Befristung von Arbeitsverträgen setzt gem. § 14 Abs. 1 S. 1 TzBfG grundsätzlich das Bestehen eines sachlichen Grundes voraus. Dieser muss im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehen (vgl. BAG, Urteil vom 17.05.2017 – Az.: 7 AZR 301/15). Fällt der sachliche Grund später weg, so bleibt die Befristung wirksam. Umgekehrt ist die Befristung unwirksam, sofern im Zeitpunkt des Vertragsschlusses kein sachlicher Grund vorlag und die Voraussetzungen der sachgrundlosen Befristung nicht vorliegen.
Mögliche Sachgründe sind (nicht abschließend) in § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG aufgezählt. Hiernach kann ein Arbeitsverhältnis insbesondere dann befristet werden, wenn
- der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
- die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,
- der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,
- die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
- die Befristung zur Erprobung erfolgt,
- in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,
- der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder
- die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
Anders als sachgrundlose Befristungen können Sachbefristungen grundsätzlich beliebig häufig und in unbegrenzter Länge hintereinander vereinbart werden, denn § 14 Abs. 1 TzBfG enthält anders als § 14 Abs. 2 TzBfG keine zeitliche oder quantitative Höchstgrenze. Der Gesetzgeber geht hier von einer verringerten Missbrauchsgefahr aus. Gleichwohl nimmt das BAG eine sog. Missbrauchskontrolle vor und überprüft, ob der Arbeitgeber die Möglichkeit der Sachgrundbefristung missbraucht (sog. institutioneller Rechtsmissbrauch). Hierbei orientiert es sich an den Grenzen der sachgrundlosen Befristung (vgl. BAG, Urteil v. 17.05.2017 – Az.: 7 AZR 420/15).
II. Sachgrundlose Befristung
Liegt kein Sachgrund für die Befristung vor, so kommt u.U. eine sachgrundlose Befristung in Betracht. Die Möglichkeit einer sachgrundlosen Befristung hat der Gesetzgeber zur Förderung des Arbeitsmarktes geschaffen. Arbeitgeber sollten flexibler Arbeitskräfte auf Zeit einstellen können. Eine solche sachgrundlose Befristung kann nach. § 14 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3 TzBfG ausnahmsweise zulässig sein im Falle einer:
1. Neueinstellung
Gem. § 14 Abs. 2 TzBfG ist eine sachgrundlose Befristung bis zur Dauer von zwei Jahren (sog. Höchstgrenze) zulässig, sofern nicht mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat (sog. Vorbeschäftigungsverbot). Früher ist das Bundesarbeitsgericht davon ausgegangen, dass eine sachgrundlose Befristung trotz eines vorherigen Arbeitsverhältnisses nicht ausgeschlossen ist, wenn dieses länger als drei Jahre zurückliegt. Diese arbeitsgerichtliche Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht als fehlerhaft angesehen (BVerfG, Beschl. v. 06.06.2018 – Az.: 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14). Danach schließt grundsätzlich jedes Arbeitsverhältnis, das zuvor bestand, eine erneute sachgrundlose Befristung aus. Ausnahmen kommen nur dann in Betracht, wenn das Arbeitsverhältnis „sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet war oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist“. Wann ein Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Rechtsprechung „sehr lange zurückliegt“ kann nicht eindeutig bestimmt werden. In einem dem BVerfG-Beschluss nachfolgenden Urteil (BAG, Urteil v. 21.08.2019 – Az.: 7 AZR 452/17) ging das BAG davon aus, dass eine 22 Jahre zurückliegende Vorbeschäftigung grundsätzlich „sehr lange zurückliegt“ und einer sachgrundlosen Befristung somit nicht entgegensteht. Umgekehrt hat das BAG ein acht Jahre zurückliegendes Arbeitsverhältnis nicht als „sehr lange zurückliegend“ in diesem Sinne eingeordnet (BAG, Urteil v. 23.01.2019 – Az.: 7 AZR 733/16).
Eine sachgrundlose Befristung, die nicht bereits von Anfang an für die Dauer von zwei Jahren geschlossen wurde, kann bis zum Erreichen der Höchstdauer gem. § 14 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 TzBfG bis zu drei Mal verlängert werden. Die Verlängerung setzt einen nahtlosen Übergang voraus, wobei die Verlängerung vor der Weiterarbeit vereinbart sein muss. Inhaltlich darf sich die Verlängerung des Vertrages ausschließlich auf die Dauer des Arbeitsvertrags beziehen. Die übrigen Arbeitsbedingungen müssen unverändert bleiben.
2. Existenzgründung
Nach § 14 Abs. 2a TzBfG ist eine sachgrundlose Befristung außerdem für die Dauer von bis zu vier Jahren innerhalb der ersten vier Jahre einer Existenzgründung zulässig. Diese Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung soll der Förderung von Unternehmensgründungen dienen. Aus diesem Zweck ergibt sich, dass das sog. „Gründerprivileg“ nicht für rechtliche Umstrukturierungen von Unternehmen und Konzernen gilt (§ 14 Abs. 2a S. 4 TzBfG).
3. Ältere Arbeitnehmer
Zudem ist eine sachgrundlose Befristung gem. § 14 Abs. 3 TzBfG für eine Dauer von bis zu fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos (§ 138 Abs. 1 Nr. 1 SGB III) war oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach dem SGB II und SGB III teilgenommen hat. Hierdurch soll die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erleichtert und gefördert werden.
III. Schriftform
Während Arbeitsverträge grundsätzlich formfrei geschlossen werden können, bedürfen sowohl die Sachbefristung als auch die sachgrundlose Befristung zu ihrer Wirksamkeit gem. § 14 Abs. 4 TzBfG der Schriftform. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen die Befristungsabrede vor Arbeitsaufnahme schriftlich vereinbaren.
Das Formerfordernis erstreckt sich hierbei ausschließlich auf die Befristungsabrede selbst und nicht auf den gesamten Arbeitsvertrag oder den Sachgrund. Wenngleich es also theoretisch möglich ist, ausschließlich die Befristungsabrede schriftlich zu vereinbaren und den restlichen Arbeitsvertrag mündlich zu schließen, sollte aus Gründen der Rechtssicherheit stets der gesamte Arbeitsvertrag schriftlich geschlossen werden. Wird gegen das Formerfordernis verstoßen, so ist nicht der gesamte Arbeitsvertrag unwirksam, sondern es entsteht automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (§ 15 TzBfG), das wegen des Vorbeschäftigungsverbotes (§ 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG) später vom Arbeitgeber nicht mehr einseitig ohne das Vorliegen eines Sachgrundes befristet werden kann.
Achtung: Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer daher auf keinen Fall mit der Arbeit beginnen lassen, bis die Befristungsabrede schriftlich vereinbart wurde. Andernfalls entsteht automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Die mündliche Abrede die Befristungsabrede später noch schriftlich zu schließen, genügt gerade nicht!
IV. Befristungskontrollklage
Wie auch bei der Kündigungsschutzklage kann der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit der Befristung nicht unbegrenzt geltend machen. Vielmehr muss er gem. § 17 S. 1 TzBfG innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage erheben und die Feststellung begehren, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der Befristung beendet wurde (sog. Befristungskontrollklage). Verpasst der Arbeitnehmer diese Frist, gilt die Befristung von Anfang an als wirksam und das Arbeitsverhältnis wird durch sie beendet.
V. Probezeit
Zum 01.08.2022 wurde in § 15 Abs. 3 TzBfG eingeführt, dass bei einem befristeten Arbeitsverhältnis eine vereinbarte Probezeit im angemessenen Verhältnis zur erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen muss. Steht die vereinbarte Probezeit nicht in einem angemessenen Verhältnis, führt dies zur Unwirksamkeit der Probezeitvereinbarung und berührt den Vertrag im Übrigen nicht.